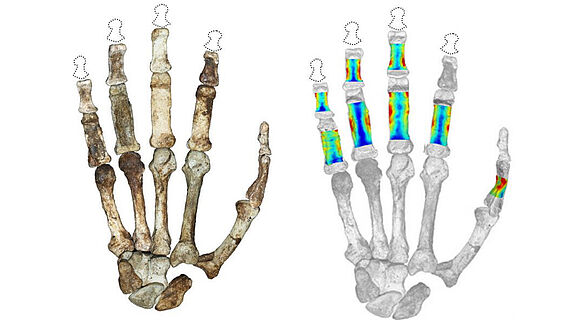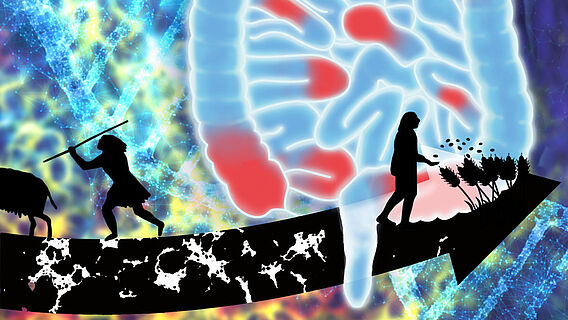Menschheitsentwicklung
Nachrichten
Videos zum Thema
Bei den jüngsten Ausgrabungen an der Blätterhöhle in Hagen ist das Forschungsteam des LWL auf weitere menschliche Funde gestoßen. Mit einem Alter von etwa 12.000 Jahren handelt es sich um die ältesten Überreste des modernen Menschen (Homo sapiens) in Westfalen. Einzuordnen sind sie damit noch in die späte Altsteinzeit. Zu den Fundstücken gehören ein Unterkieferfragment sowie einige Zähne und Zahnfragmente eines etwa sieben Jahre alten Kindes und der abgenutzte Zahn eines Erwachsenen. Die Funde stammen aus einem ungestörten Schichtzusammenhang – dies ist einzigartig in NRW und den angrenzenden Regionen. Das Video ist eine Aufzeichnung des Livestreams vom Pressetermin am 26.05.2023 auf dem Vorplatz der Blätterhöhle. Wolfgang Heuschen (Grabungsleiter der Stadtarchäologie Hagen) sowie Dr. Jörg Orschiedt (langjähriger Leiter des Forschungsprojekts) präsentierten die Funde und ordneten sie in den (prä-)historischen Kontext ein.
Die neuen Menschenfunde stammen aus einer ausgesprochenen Kaltphase, die Zeit der letzten Rentierjäger (Ahrensburger Kultur). Die Datierung einzelner Rentierknochen aus der Höhle „Hohler Stein“ im Kreis Soest stimmen mit denen der neuen Fundschicht an der Blätterhöhle überein. An der Blätterhöhle wurden jedoch keine Knochen von Rentieren gefunden, sondern nur die Überreste von Rothirschen. Alles deutet darauf hin, dass es vor 12.000 Jahren innerhalb kürzester Zeit zu einem dramatischen Klimawandel kam. Flora und Fauna mussten sich an diese kurzfristige Erwärmung anpassen. Der Wandel hat zudem zu einer Migration von Tier und Mensch aus benachbarten Gegenden und Regionen geführt.
Hightech in der Steinzeit
Der älteste Kunststoff der Menschheitsgeschichte
Im Bereich des ehemaligen Ortes Königsaue bei Aschersleben wurden in den 1960er Jahren durch Prof. Dr. Dietrich Mania sensationelle Funde gemacht. Sie zeigen uns den Stand der technischen Spitzenproduktion vor über 80.000 Jahren. Was ist der älteste »Kunststoff« der Menschheitsgeschichte? Wie wurde er in der Steinzeit verwendet? Und was hat das mit dem Fingerabdruck eines Neandertalers zu tun? Diese und weitere Fragen beantwortet Museumsdirektor Harald Meller in dieser Folge der Reihe »Museum exklusiv«. Im Rahmen einer Kurzführung wird dieses Highlight der Archäologie anhand der im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) ausgestellten Exponate beleuchtet.
Gekommen um zu bleiben
Eine kurze Urgeschichte Westfalens 3/6
Die Themen der dritten Folge der Reihe »Eine kurze Urgeschichte Westfalens« reichen von der Wanderung des anatomisch modernen Menschen von Afrika nach Europa und Westfalen und das Verhältnis zum dort lebenden Neanderthaler bis hin zur Neolithischen Revolution.
Die ersten Europäer
Eine kurze Urgeschichte Westfalens 2/6
In der zweiten Folge der Beitragsreihe »Eine kurze Urgeschichte Westfalens« stellt David Johann Lensing die ersten Europäer und den ältesten Fund eines von Menschen gefertigten Werkzeugs in Nordrhein-Westfalen vor.
Vom Klima getrieben
Eine kurze Urgeschichte Westfalens 1/6
»Eine kurze Urgeschichte Westfalens« ist eine Beitragsreihe mit sechs Video-Essays rund um die westfälische Urgeschichte und den Werdegang der ersten Menschen. Produziert wurde sie vom LWL-Medienzentrum für Westfalen in Kooperation mit dem Autor und Content Creator David Johann Lensing aus NRW. Nach dem Vorbild von Yuval Noah Harari (»Eine kurze Geschichte der Menschheit«) und unterstützt von Fachleuten des LWL erzählt David in dieser Reihe die Urgeschichte seiner Heimatregion. In der ersten Folge geht es um den Zusammenhang der globalen Klimaentwicklung und die Anpassung der ersten Menschen in Ostafrika.
Podcasts zum Thema
Wieviel haben wir mit Neandertalern gemeinsam?
Tonspur Wissen
Sie kümmerten sich empathisch um Alte und Kranke, konnten sprechen und betrieben Landschaftspflege: Erstaunlich viel verbindet uns mit den Neandertalern. Was können wir aus der Archäologie über unsere Gegenwart lernen? Ursula Weidenfelds Gesprächspartnerin Sabine Gaudzinski-Windheuser leitet das Archäologische Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution (MONREPOS) des Römisch-Germanischen Zentralmuseums - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie (RGZM).
Built on bones: the history of humans in the city
Ian Sample spricht mit Bioarchäologin Brenna Hasset über die menschliche Evolution und unser Verhältnis zu einem urbanen Lebenstil (31:46)
Ian Sample and bioarchaeologist Brenna Hassett explore the history of our relationship with an urban lifestyle – the good, the bad, and the ugly
Aus der Reihe "The Guardian's Science Weekly"