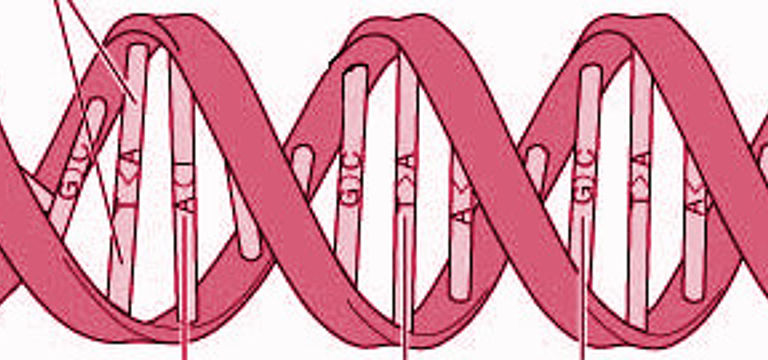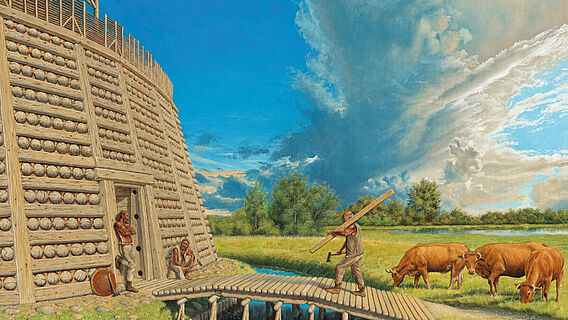Methoden
Nachrichten
Videos zum Thema
Archäologisches Zeichnen: Bronzenes Randleistenbeil
Zeichenblog der LWL-Archäologie
Die archäologische Zeichnerin Petra Altervers in der Außenstelle Münster der LWL-Archäologie lässt bei ihrer Arbreit am Zeichentisch intensiv über ihre Schulter schauen. Das Video ist der Auftakt der Reihe »Zeichenblog« und beantwortet die Frage, warum archäologische Funde überhaupt gezeichnet werden, bzw. welche Vorteile eine archäologische Zeichnung gegenüber Fotografien haben.
Aufzeichnung eines knapp viertelstündigen Vortrages von Leo Klinke über die Ausgrabungen am Megalithgrab Beckum-Dalmer (Beckum II). Das zur Beckumer Gruppe im Grenzbereich zwischen dem Verbreitungsgebiet der Trichtberbecherkultur im nördlichen Westfalen und dem südlich davon gelegenenen der Wartberg-Gruppe gehörende Großsteingrab wurde bereits im 19. Jahrhundert und den 1970er Jahren teilweise ausgegraben. 2021 fanden weitere Untersuchungen statt, die u.a. zur Klärung der Frage beitragen sollten, welcher der beiden archäologischen Kulturen diese Anlage zuzurechnen sei. Dabei wurden die obertägig sichtbaren Reste dreidimensional dokumentiert, wobei sich zeigte, dass die überlieferten Pläne der Altgrabungen nicht ganz korrekt sein konnten. Geophysikalische Untersuchungen im näheren Umfeld zeigten Anomalien, aus denen sich auf die ursprüngliche Architektur schließen läßt. Drei kleinere Sondageschnitte erbrachten schließlich weitere Hinweise zur Einordnung des Bodendenkmals.
Von Gräbern, Menschen und Landschaft
Vortrag von Christoph Rinne über die Megalithgräber im Haldensleber Forst
Unter dem übergeordneten Thema »Mensch und Landschaft« befasst sich der Vortrag überwiegend mit den 117 Megalithgräbern auf einer Fläche von ca. 140 km² bei Haldensleben westlich von Magdeburg. Beginnend mit der Erforschung dieser kleinen aber hohen Konzentration von Megalithgräbern am Übergang zwischen norddeutschem Tiefland und den Mittelgebirgen wird vor allem die Interaktion des steinzeitlichen Menschen mit seiner Umwelt dargestellt. So wird die Frage nach der Datierung der Gräber und die Entwicklung des Denkmalbestandes innerhalb der Kleinregion mit der Verfügbarkeit von Ressourcen verbunden. Die bekannten, gleichzeitigen Siedlungen der Steinzeit eröffnen den Blick auf den angrenzenden Raum der Lebenden und führen zu der Frage nach einer möglichen Konzeption der Landschaftsnutzung. Um das mit Megalithgräbern gerne verbundenen Thema Monument und Erinnerung aufzugreifen, wird abschließend auch auf jüngere Analysen zu einem steinzeitlichen Grab in Hessen eingegangen.
Der Vortrag wurde am 12.5. auf dem Kanal des LWL-Museums für Archäologie per Livestream auf Youtube übertragen.
Archäologen suchen in der Erde nach den Spuren aus der Vergangenheit. Inzwischen machen sie das aber nicht mehr ausschließlich mit dem Spaten. Moderne Geräte und Messmethoden sind längst Alltag für Wissenschaftler und Grabungsteams geworden. Luftbildarchäologie, Laserscanning, Geomagnetik und Geoelektrik ermöglichen es, vom Büro aus unter die Erde zu schauen und Plätze zu definieren, an denen eine aufwendige Grabung Erfolg verspricht.
Komplexes einfach zu erklären, ist eine Kernkompetenz der Macher der aus der »Sendung mit der Maus« bekannten Sachgeschichten. Die komplette »Bibliothek der Sachgeschichten« ist auf DVD erhältlich, hier können Sie die knapp halbstündige Folge zum Thema Archäologie anschauen.
Die Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns ist über Jahrtausende gewachsen. Man muss nicht weit reisen, um alte Kulturen und magische Orte zu erleben. Der Film zeigt Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich um das archäologische Kulturerbe in Mecklenburg-Vorpommern und seine Vermittlung kümmern. Der Bogen reicht von der Erfassung bis zur Ausstellung.
Podcasts zum Thema
Von Schaufeln und Metalldetektoren
AMH005
In der fünften Episode des AMH-Podcasts wird es schmutzig: Dr. Jochen Brandt, Leiter der Bodendenkmalpflege Landkreis Harburg, erklärt Moderator Bent Jensen die Aufgaben und Abenteuer der Bodendenkmalpflege, wie er die Archäologie auch für Laien zugänglich macht und warum er die typisch archäologische Kelle verschmäht.
Die Ausgrabung auf der Cremon-Insel
AMH002: Holzkisten und Keramikschuhe
In der zweiten Folge des AMH-Podcasts sind Kay-Peter Suchowa und Judith Kirchhofer zu Gast bei Moderator Julian Gebhardt. Die beiden Archäologen berichten von der Ausgrabung auf der ehemaligen sogenannten Cremon-Insel mitten im Zentrum Hamburgs. Sie erzählen von ihrer aktuellen Arbeit, dem Ablauf einer Grabung und der Siedlungsgeschichte der Cremon-Insel. Man erfährt, wie es zu der Ausgrabung kam, was dabei herauskam und vielleicht noch dort verborgen liegt.
Digitalität in der Archäologie
In der dreizehnten Folge des hafenradio Podcasts geht es um das Thema »Digitale Grabungstechnik- und Dokumentation, riesige Datenmengen und der Wert der Daten oder wie sieht digitale Archäologie 2026 aus?«. Zu Gast ist Kai-Christian Bruhn, Professor im Fachbereich Technik – Geoinformatik & Vermessung an der Hochschule Mainz. (1:44:54)
Zur Internetseite dieser Podcastfolge mit ausführlichem Inhaltsverzeichnis und weiteren Infos