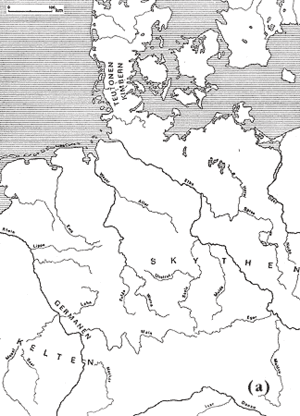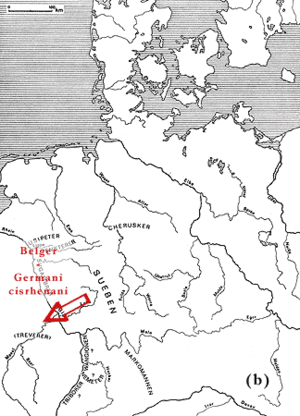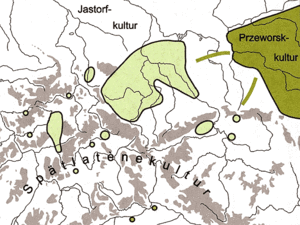Unruhige Zeiten
Das dritte Jahrhundert vor Christus
Im Jahr 230 v.Chr. sahen sich die Einwohner Olbias, einer griechischen Stadt an der nördlichen Schwarzmeerküste, plötzlich einer bislang unbekannten Gefahr ausgesetzt. Ihre Stadt wurde von den Bastarnen und den Skiren belagert, zwei Barbarenstämmen, die aufgrund dieses kriegerischen Verhaltens erstmals in den historischen Quellen Erwähnung finden. Was jedoch hat die Schnippenburg, eine kleine Höhenbefestigung am äußersten nordwestlichen Rand der deutschen Mittelgebirge mit dem tausende Kilometer entfernten Olbia zu tun? Nun, die Ereignisse an der Schwarzmeerküste sind ein ferner Widerhall dessen, was im nördlichen Mitteleuropa im dritten Jahrhundert vor Christus geschah, und damit quasi der einzige historische Niederschlag dieser Ereignisse. Die Bastarnen lassen sich anhand archäologischer Quellen auf Bevölkerungsgruppen zurückführen, die ursprünglich an der südwestlichen Ostseeküste ansässig gewesen waren. Was genau sie dazu gebracht hatte, ihre Heimat zu verlassen, ist unbekannt. Es sind aber wohl Umstände gewesen, die sich auf zweierlei Art im ganzen nördlichen Mitteleuropa auswirkten: auf der einen Seite durch die Mobilisierung der Bevölkerung, auf der anderen durch den Bau von Befestigungen wie der Schnippenburg. Unruhige Zeiten also.
Am Anfang - eine Begriffsbestimmung
Das dritte Jahrhundert vor Christus gehört in eine Epoche, die von den Archäologen in Nord- und Nordwestdeutschland als vorrömische Eisenzeit bezeichnet wird. Warum? Archäologen pflegen Kulturen und Epochen nach bestimmten Kriterien voneinander abzugrenzen und nach berühmten Fundorten, typischen Objekten oder geographischen Gegebenheiten zu bezeichnen. Das Dreiperiodensystem Steinzeit - Bronzezeit - Eisenzeit, das die grundlegende Abfolge der kulturgeschichtlichen Entwicklung Europas widerspiegelt, ist ein Beispiel dafür. Die vorrömische Eisenzeit liegt, soviel ist klar, in deren letztem Abschnitt. Des Weiteren grenzt der Begriff vor-römisch sie von einer Zeit ab, die römisch ist oder doch zumindest römisch geprägt.
Die vorrömische Eisenzeit folgt auf die Bronzezeit und umfasst die letzten sieben Jahrhunderte vor Christi Geburt
Was im Norden als vorrömische Eisenzeit bezeichnet wird, ist im Süden die Eisenzeit schlechthin, und man gliedert sie in die (ältere) Hallstattzeit und die (jüngere) Latènezeit. Beide Namen gehen zurück auf zeittypische Fundorte, die zu Beginn der archäologischen Forschung so herausragend waren, dass man sie nicht nur für die Epoche, sondern zugleich auch für die in dieser Zeit existierenden Kulturen verwendete. Es heißt also auch Hallstattkultur und Latènekultur, und beides zusammen bildet die Kultur jener Menschen, die einen wesentlichen Teil des Volks der Kelten ausmachten.
Die Protagonisten - Kelten und Germanen?
Das erste Jahrtausend vor Christus wird in Süddeutschland deshalb auch als das keltische Jahrtausend bezeichnet, wodurch die beiden wesentlichen kulturgeschichtlichen Erscheinungen, die Hallstattkultur und die Latènekultur, eine ethnische Komponente erhalten. Dies geht zurück auf antike Schriftquellen aus der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus, die sich auf die Menschen beziehen, die zu dieser Zeit das südliche Mitteleuropa in einem weiten Bogen von Frankreich über Süddeutschland bis in den Ostalpenraum bewohnten. Sie wurden von den Griechen und Römern als keltoi oder Gallier bezeichnet. Nun suggeriert eine solche Sammelbezeichnung zumeist auch Vorstellungen von Gemeinsamkeiten und einer Art Zusammengehörigkeitsgefühl, und dies ist aus archäologischer Sicht problematisch. So lassen sich zwar in der "keltischen" Welt zahlreiche kulturelle Gemeinsamkeiten feststellen - sonst könnten wir ja gar nicht von der Hallstatt- und der Latènekultur sprechen -, der ethnische Aspekt wird in jüngerer Zeit aber zunehmend skeptisch gesehen, und dies nicht ohne Grund. Ein kurzer Exkurs möge dies erläutern.
Ethnizität ist ein soziales Konstrukt (und mit den archäologischen materiellen Quellen daher nur unzureichend zu erfassen), das bestimmte gesellschaftliche Funktionen erfüllt. Sie trägt dazu bei, menschliche Gemeinschaften und ihr soziales Umfeld zu strukturieren. Soziale Bindungen innerhalb der Gemeinschaft werden durch sie gestärkt und Verbindungen zu anderen Gemeinschaften erleichtert oder aber im Gegenteil erschwert. Unumstößlich und unwandelbar sind sie aber nicht, denn ethnische Bindungen sind mitunter nur schwach ausgebildet oder gar nur latent wirksam, d.h. evtl. nur zu bestimmten Anlässen. In solchen Fällen kann Ethnizität opportunistisch genutzt bzw. regelrecht manipuliert werden, und dies insbesondere in Krisenzeiten. Das mag aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar sein, wird aber verständlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass in schriftlosen Gesellschaften Vergangenes über Erzählungen, Mythen und Rituale tradiert werden muss, die einer Erläuterung durch Eingeweihte bedürfen. Eine Umdeutung der Geschichte fällt hier wesentlich leichter.
Kehren wir mit diesem Hintergrundwissen zu den "Kelten" zurück, dann machen die antiken Quellen stutzig. Sie berichten nämlich von zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den keltischen Stämmen. Insbesondere der gallische Widerstand gegen die römische Eroberung, der im Wesentlichen von einzelnen Stämmen oder Stammesbündnissen getragen wurde, nicht jedoch von allen Galliern gemeinsam, lässt den Willen, als gemeinschaftliches Ethnos zu reagieren, eher vermissen denn erahnen. Wer oder was DIE Kelten waren, wird damit eine Frage, die nur schwer zu beantworten sein dürfte. Wenn im vorliegenden Beitrag nachfolgend von Kelten gesprochen wird, dann ist dies in erster Linie als sprachliche Vereinfachung zu verstehen.
Noch schwerer als bei den Kelten ist es, die Germanen in der vorrömischen Eisenzeit räumlich, geschweige denn ethnisch zu verorten. Die Schwierigkeit beginnt schon damit, dass der Begriff des Germanischen unterschiedliche Wurzeln hat. Da wären zum einen die germanischen Sprachen, deren älteste Relikte, zumeist Orts- und Gewässernamen, in Skandinavien und Norddeutschland zu lokalisieren sind. Die frühesten römischen Quellen, in denen die Germanen erscheinen, beziehen sich zunächst noch sehr global auf Stämme aus dem nördlichen Mitteleuropa. Die erste gesicherte Erwähnung findet sich in einer Abschrift eines Werks von Poseidonios, die auf das Jahr 80 v. Chr. zurückzuführen ist. Dort geht es um die Essgewohnheiten der Germanen, hier allerdings so toposhaft dargestellt, dass nicht einmal klar wird, ob der Autor nicht eher einen keltischen Teilstamm beschrieb als ein eigenständiges Volk. Die eigentliche Ausformung und geographische Platzierung erhält der Germanenbegriff aber erst durch Gaius Julius Cäsar, der während der Eroberung Galliens und Belgiens in den 50ern den Rhein zur Völkerscheide zwischen Kelten und Germanen erhob. Nun geht die Forschung heute allerdings davon aus, dass Cäsars Rheingrenze ein politisches Konstrukt war, das die Annexion Galliens in ihrer tatsächlichen Form legitimieren sollte. Cäsars Angaben sind daher fragwürdig. Und so verwundert es nicht, dass in Süddeutschland eben auch Kelten rechts des Rheins zu finden sind, im Mittelrheingebiet hingegen Germanen links des Flusses. Dort traf Cäsar bei der Eroberung der von den Belgern bewohnten Gebiete nämlich auf Stämme, die er als Germani cisrhenani
Soweit sich Cäsar auf das Mittelrheingebiet bezieht, ergibt sich nun aber ein Problem, denn der Mittelgebirgsraum gehört weder archäologisch noch sprachwissenschaftlich zum germanischen Kernraum. Bereits Cäsars Germanenbegriff scheint also nicht dasselbe zu meinen wie der sprachwissenschaftliche oder der archäologische. Die wesentlichen römischen Quellen, von denen sich der Germanenbegriff letztlich herleitet, beziehen sich also auf ein Gebiet, das unter anderen Gesichtspunkten eben nicht als germanisch anzusehen wäre. Viele Altertumsforscher haben diesen Konflikt früher nicht gesehen oder ignoriert und den Mittelgebirgsraum einfach als germanisch bezeichnet. Mittlerweile hingegen tendiert die Forschung eher zu einem integrativen Germanenverständnis. Demzufolge wären Bevölkerungen unterschiedlicher kultureller, sprachlicher und ethnischer Herkunft im Laufe der Zeit zum Volk der Germanen verschmolzen, wobei die römische Expansion erhebliche Impulse von außen geliefert zu haben scheint. So dürften manche Stämme sich in gemeinsamem Widerstand verbunden haben, während andere durch die römische Kriegführung weitgehend zerschlagen wurden und sich die Überlebenden dann anderen Gruppen anschlossen
Als Fazit bleibt festzuhalten: Von den beiden Protagonisten der vorrömischen Eisenzeit, den Germanen und den Kelten, lassen sich lediglich letztere einigermaßen sicher in Süddeutschland verorten. Bei den Germanen ist es nicht sicher, ob sie im Mittelgebirgsraum oder in der norddeutschen Tiefebene lebten, wenn es so etwas wie die Germanen zu dieser Zeit denn überhaupt schon gegeben hat. Ob sich diese Völker aber selbst so verstanden, geschweige denn bezeichnet haben, ist eine Frage, die kaum zu beantworten ist.
Die vorrömische Eisenzeit im Norden - in Armut alle gleich
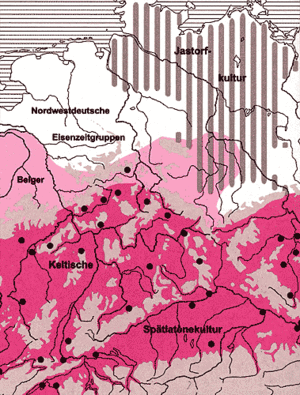
Im norddeutschen Flachland tritt uns mit der Jastorfkultur eine Gesellschaft entgegen, die sich vielleicht am besten so beschreiben lässt: "In Armut alle gleich". Denn bekannt sind in erster Linie große und kleine Gräberfelder, auf denen die verbrannten Verstorbenen in unscheinbaren Urnen aus Ton beigesetzt wurden und, wenn überhaupt, dann einige wenige Trachtbestandteile aus Bronze oder Eisen mit ins Grab erhielten. Nun ist diese Beobachtung zu einem gewissen Teil zweifellos durch verschiedene Faktoren verzerrt - etwa durch die Erhaltungsbedingungen für organische Objekte, die weder den Scheiterhaufen noch die jahrtausendelange Bodenlagerung überdauert haben, oder aber durch rituelle oder soziale Gegebenheiten, die regelten, was die Toten mit ins Grab erhalten durften -, aber die auffallende Gleichförmigkeit ist schon bemerkenswert. Zudem deckt sie sich mit dem, was wir von den Siedlungen wissen, die nämlich über viele hundert Kilometer hinweg recht gleichartig strukturierte, einfache bäuerliche Ansiedlungen gewesen zu sein scheinen.
Der Beginn der Eisenzeit, der in die Jahrzehnte um 700 v.Chr. zu datieren ist, scheint hingegen keinen sonderlichen und schon gar keinen epochalen Umbruch mit sich gebracht zu haben, wie dies die ursprüngliche Konzeption des Dreiperiodenmodells noch vermittelt. Das Erlernen der Technologien der Eisenverhüttung und -verarbeitung scheint ein langwieriger Prozess gewesen zu sein und die ersten zwei bis drei Jahrhunderte der vorrömischen Eisenzeit in Anspruch genommen zu haben. Dies ist eigenartig, denn im Gegensatz zu den Bestandteilen der Bronze, Kupfer und Zinn, ist Eisen in Norddeutschland vielerorts in Form von Raseneisenerz gebunden und sehr leicht im Tagebau zu gewinnen. Kupfer und Zinn mussten hingegen in den Norden importiert werden, weil es dort keine Lagerstätten gibt, und so waren die Hersteller und Besitzer von Bronzeobjekten während der gesamten Bronzezeit auf gut funktionierende Handels- oder Tauschsysteme angewiesen. Dennoch verlief der Technologietransfer aus dem südlichen Mitteleuropa, wo man die Eisenherstellung bereits seit dem neunten Jahrhundert beherrschte, scheinbar schleppend. So gibt es bis zum dritten Jahrhundert nur sehr wenige eindeutig datierte Verhüttungsplätze und auch Zahl, Gewicht und Qualität der als Grabbeigabe verwendeten Eisenobjekte sprechen für eine geringe Produktion in dieser Zeit.

Die Gründe hierfür liegen im Dunkeln. Möglicherweise war der Norden aus dem Blickfeld der Tauschpartner im südlichen Mitteleuropa geraten, denn die Menschen dort, insbesondere die Angehörigen der Oberschicht, orientierten sich im sechsten und fünften Jahrhundert stark an den mediterranen Zivilisationen der Griechen und Etrusker. Vielleicht führte dies zum Zusammenbruch der alten Tauschsysteme und der Norden geriet aufgrund seiner peripheren Lage zu den neuen Systemen in eine unfreiwillige Isolation. Die Folge war ein Zusammenbruch der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. Über ein Jahrtausend lang hatte die bronzezeitliche Oberschicht des Nordens ihren Status durch den Besitz und die Kontrolle des Handels mit Bronzeobjekten legitimiert (wie dies genau auch immer funktioniert haben mag) und diese Legitimation war nun weggebrochen. Tatsächlich löst sich die alte Oberschicht in den archäologischen Quellen in Luft auf.
Zu Beginn des dritten Jahrhunderts geschah dann jedoch etwas, was für die Folgezeit erhebliche Auswirkungen hatte. Nachdem die Menschen in Norddeutschland für mehrere Generationen weitgehend isoliert gewesen waren, sei dies nun freiwillig oder unfreiwillig geschehen, wurden sie sich der Existenz einer fremden Kultur gewahr, der Latènekultur nämlich, und sie begannen, Teile dieser Kultur zu übernehmen. Archäologisch spiegelt sich das darin wieder, dass die als Grabbeigabe verwendeten Trachtbestandteile mehr und mehr nach latènoiden Vorbildern angefertigt wurden. Eindeutig als Import zu klassifizierende Funde bleiben hingegen die Ausnahme. Importiert wurde also vielmehr eine Idee, eine Art "Modetrend", nicht der dingliche Niederschlag dieser Idee.

Im Gegensatz zum Norden ist im Süden in der Hallstatt- und auch noch in der älteren Latènekultur, also bis in das vierte Jahrhundert hinein, sehr deutlich eine Oberschicht fassbar. Die Angehörigen dieser Oberschicht lebten in befestigten Höhensiedlungen und ließen sich in großen Grabhügeln bestatten. Im vierten Jahrhundert geriet die so konstituierte Gesellschaft jedoch in Bewegung. Keltische Lebensweise und keltische Bevölkerung breiteten sich aus, und zwar keineswegs friedlich. Im Jahr 387 v.Chr. eroberte Brennus mit seinen Leuten Rom, 279 v. Chr. wurde das Orakel von Delphi in Griechenland geplündert und Kelten ließen sich in ganz Frankreich, in Norditalien, auf dem Balkan und sogar in Anatolien nieder. Die keltische Expansion ist archäologisch versinnbildlicht darin, dass der Mann in seinem Status als Krieger bestattet wird. Er erhält Schwert, Lanze und Schild - zumindest Teile dieser Vollbewaffnung - mit ins Grab, ein krasser Gegensatz zu den Männern in Norddeutschland. Kleinere keltische Expansionen gingen Richtung Südthüringen, Böhmen und Mähren sowie nach Schlesien. Sie spielten für den Norden die entscheidende Rolle, denn an dieser nordöstlichen Flanke der keltischen Welt berührten sich nunmehr die Latènekultur und die nordmitteleuropäische Brandgräberkultur.
Das dritte Jahrhundert - ein neues Zeitalter beginnt
So konnte sich ein starker Kontrast entwickeln. Die Menschen im Norden lebten in einer fragmentierten Gesellschaft, einer Gesellschaft aus kleinen und kleinsten sich selbst versorgenden Gruppen, in der weder die Möglichkeit noch die Notwendigkeit bestand, Überschüsse zu produzieren, sei es für den Handel oder für den Erwerb von Statussymbolen. Diese Menschen sahen sich nun plötzlich der Latènekultur gegenüber: expansiv, politisch und militärisch erfolgreich, die Männer mit guten Waffen ausgerüstet, die Frauen mit reichen Schmuckausstattungen.
Es ist für uns moderne Menschen mit unseren weitreichenden geographischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen kaum möglich, sich in das Vorstellungsvermögen von Menschen aus vorgeschichtlicher Zeit zu versetzen. Eines aber ist verständlich und zeigt sich auch genau in dem weiter oben geschilderten archäologischen Befund: Die Latènekultur muss auf die norddeutsche Bevölkerung ausgesprochen attraktiv gewirkt haben und zweifelsohne ist durch diese Attraktivität der Impuls ausgelöst worden, sich selbst zu "latènisieren". Zunächst äußerte sich dies wie erwähnt lediglich in der Anpassung des Trachtzubehörs
Manchen scheint dieses distanzierte Nachahmen allerdings nicht gereicht zu haben. Vielleicht fühlten diese Leute sich durch die heimische Kultur eingeengt, nachdem sie bei den Kelten ein anderes Lebensmodell kennengelernt hatten. Auf jeden Fall verließen nun einige von ihnen ihre Heimat rund um die südwestliche Ostseeküste. Sie zogen in den Südosten Europas und traten als die bereits erwähnten Bastarnen in das Licht der Geschichte ein
Ihrem Vorbild folgten in den kommenden zweieinhalb Jahrhunderten immer wieder größere Bevölkerungsgruppen. Teilweise ist dies aus historischen Quellen bekannt, teilweise aus archäologischen, worin sich ein eigenartiges, aber nicht unbekanntes Überlieferungsproblem zeigt, denn beide Quellengattungen schließen sich weitgehend aus. Der Zug der Kimbern und Teutonen beispielsweise, der Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus diese vermutlich ursprünglich in Nordjütland beheimateten Stämme durch halb Mitteleuropa bis nach Südfrankreich und Norditalien führte, ist archäologisch überhaupt nicht fassbar. Umgekehrt lässt sich allein mit archäologischen Quellen rekonstruieren, dass sich Bewohner aus dem südwestlichen Polen in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts nach Westen aufmachten. Insgesamt wird ersichtlich, dass die vorrömische Eisenzeit eine Zeit hoher Mobilität war - oder besser vielleicht: geworden war.
Diese Mobilität nun muss großes Konfliktpotential in sich geborgen haben. Da waren zum einen die Motive derjenigen, die unterwegs waren, manche vielleicht auf der Jagd nach Beute, die auf Kriegszügen zu machen war, manche auf der Suche nach einer neuen Heimat. Für die Sesshaften galt es also, ihr Land, ihre Besitztümer und vielleicht sogar ihr Leben zu verteidigen. Selbst wenn die Neuankömmlinge nur auf der Durchreise waren, dürften sich daraus schon erhebliche Probleme für alle Beteiligten ergeben haben. Denn es ist zu bezweifeln, dass in der vorrömischen Eisenzeit genug Überschüsse erzeugt werden konnten, um Fremde über längere Zeiträume, vielleicht sogar über einen ganzen Winter hinweg, mit Nahrung zu versorgen. Man war also vielleicht gar nicht in der Lage, freiwillig zu teilen - wenn man denn überhaupt dazu bereit gewesen wäre
Das Land in der Mitte - der Mittelgebirgsraum
In diesem konfliktträchtigen Milieu wurden zu Beginn des dritten Jahrhunderts im Mittelgebirgsraum zwischen dem Thüringer Wald im Osten und dem Rhein im Westen zahlreiche Höhenbefestigungen errichtet. Ähnliche Burgen hatte man bereits zuvor, im sechsten und fünften Jahrhundert, gebaut. Sie waren aber nach und nach aufgegeben worden. Nun jedoch gab es offensichtlich erneut Anlass, sich durch solche Anlagen zu schützen. Das Aussehen und die Funktion dieser Burgen sind vielgestaltig. Man baute sie auf Bergkuppen, -kämme oder -sporne und versah sie mit unterschiedlich aufwendig gestalteten Befestigungslinien. Diese bestanden aus Stein, Holz und Erde, mit denen man manchmal nur die gefährdeten Zugangsbereiche, häufig aber auch das gesamte Areal sicherte. Da viele der Höhenbefestigungen gar nicht oder nur teilweise archäologisch untersucht sind, ist über das, was in ihnen geschah, kaum etwas bekannt. Manche der Burgen scheinen nur in Krisenzeiten aufgesucht worden zu sein, manche waren hingegen dauerhaft bewohnt und scheinen überdies eine besondere Rolle im religiösen Leben ihrer Bewohner gespielt zu haben (vgl. hierzu den Beitrag von J. SCHULZE-FORSTER).

Von den Menschen, die die Befestigungen des Mittelgebirgsraums erbauten, ist im Übrigen jedoch nicht viel bekannt, denn aus diesem Gebiet sind nur wenige Siedlungen und Bestattungsplätze überliefert. Ein Merkmal, das die Bewohner der Mittelgebirge mit den Menschen in Norddeutschland teilen, ist die Öffnung gegenüber der Latènekultur, die sich hier jedoch anders äußert. So findet man im Mittelgebirgsraum Trachtbestandteile und Waffen, die weitaus eher als die latènoiden Objekte Norddeutschlands echte keltische Importe sein könnten oder sogar mit Gewissheit sind. Und als sich im zweiten Jahrhundert bei den Kelten Ansätze einer urbanen Kultur mit eigenem Münzwesen und Massenproduktion herausbildeten (die späte Latènezeit wird deshalb auch als Oppida-Zivilisation bezeichnet
Der Nordwesten - am Rande der bekannten Welt

Am nördlichen Rand der Mittelgebirge sind Anzeichen für intensivere Kontakte zur Latènekultur deutlich geringer, wobei der archäologische Quellenbestand allerdings auch als ziemlich dürftig zu bezeichnen ist. Eine besondere Rolle nehmen dort die Höhenbefestigungen ein, die im äußersten Nordwesten dieses Gebiets auf den Kämmen des Teutoburger Waldes und des Wiehengebirges errichtet wurden und von denen die Schnippenburg den am weitesten abgelegenen Fundplatz bildet. Im Flachland jedenfalls, das diese Höhenzuge auf drei Seiten umgibt - in der Westfälischen Bucht, am Niederrhein und im westlichen Niedersachsen - befindet man sich nach den wenigen bekannten archäologischen Quellen in einem anderen kulturellen Umfeld, welches in sich freilich keineswegs eine Einheit bildet. Was den Nordwesten eint, sind im Wesentlichen ähnliche Bestattungssitten. Die Verstorbenen wurden hier verbrannt und unter kleinen Grabhügeln bestattet, zu denen Kreisgräben, manchmal auch viereckige Gräben gehören.
Burgen aber gibt es hier nicht. Nun ist klar, dass dort, wo es keine Berge und keine Steinbrüche gibt, auch keine Befestigungen nach Art der Schnippenburg gebaut werden konnten. Andererseits gibt es aber im norddeutschen Flachland im Frühmittelalter zahlreiche Befestigungen, die eine für die dortigen Verhältnisse gangbare Bautradition in Form von Holz-Erde-Wällen aufzeigen
Die Schnippenburg - ein interkulturelles Experiment?
Ist es nun aber vorstellbar, dass auf den relativ flachen Mittelgebirgsausläufern des Wiehengebirges und des Teutoburger Waldes, die sich als schmaler Streifen in die nordwestdeutsche Tiefebene hineinschieben, eine andere Bevölkerung gelebt haben soll als im Flachland? Die Idee, eine solche Anlage zu errichten, und die dabei verwendeten Bautechniken stammen ohne jeden Zweifel aus dem Mittelgebirgsraum. Das Fundmaterial hingegen erzeugt kein so klares Bild. Keltische und keltisch inspirierte Funde sind auf der Schnippenburg ebenso vorhanden wie Gegenstände, die in der Region, in Nordwestdeutschland und im Bereich der Jastorfkultur zu finden sind. Dies hat zweifellos mit der Funktion der Schnippenburg zu tun, denn sie liegt im Kreuzungspunkt verschiedener Fernverbindungswege, die auch schon in der vorrömischen Eisenzeit eine Rolle gespielt haben dürften. Sie kann daher als ein Zentralort angesehen werden, obwohl diese "Zentralörtlichkeit" in ihrer genauen Bedeutung vorerst noch genau so unbestimmt bleibt wie die Größe ihres Einzugsgebiets.
Wer auch immer die Schnippenburg geplant und gebaut hat, er scheint das Experiment unternommen zu haben, in der Region einen sicheren Standort zu schaffen, einen Platz, an dem vielleicht Handel und kultureller Austausch zwischen verschiedenen Ethnien möglich sein sollten. Dies mögen Menschen aus der Gegend gewesen sein. Vielleicht war die Schnippenburg aber auch eine Art militärischer, wirtschaftlicher oder kultureller Vorposten eines Stammes oder Stammesverbunds aus dem Mittelgebirgsraum, quasi Handelsstation und Mission in einem.
Dann hätten ihre Bewohner sicher wie die griechischen Kolonisten in Olbia mit der Furcht leben müssen, von wilden Barbaren überfallen zu werden. Im Gegensatz zu Olbia allerdings ist die Schnippenburg diesem Schicksal scheinbar nicht heil entkommen. Funde und Befunde zeigen, dass ihre Befestigungsanlagen nach relativ kurzer Zeit, möglicherweise nach nur wenigen Jahrzehnten, einem Brand zum Opfer fielen, dessen Ausmaße nur den Schluss einer absichtlichen Zerstörung zulassen. Die Schnippenburg wurde danach nicht wieder aufgebaut, das Experiment war gescheitert.
Weiterführende Literatur
H. AMENT 1984: Der Rhein und die Ethnogenese der Germanen. - In: Prähistorische Zeitschrift 59, 1984, 37-47.
J. BRANDT 2005: Ein verlorenes Zeitalter? - Die vorrömische Eisenzeit in Mecklenburg-Vorpommern (550 v.Chr. - Christi Geburt). - In: H. JÖNS / F. LÜTH (Hrsg.), Die Autobahn A20 - Norddeutschlands längste Ausgrabung. Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern 4. Schwerin 2005, 81-82.
H. DANNHEIMER / R. GEBHARD (Hrsg.) 1993: Das keltische Jahrtausend. Landesausstellung des Freistaates Bayern, Prähistorische Staatssammlung, und der Stadt Rosenheim vom 19. Mai-1. November 1993 im Lokschuppen Rosenheim. Ausstellungskataloge der Prähistorischen Staatssammlung 23. Mainz 1993.
H.-J. HÄßLER (Hrsg.) 1991: Ur- und Frühgeschichte in Niedersachsen. Stuttgart 1991.
J. HERRMANN (Hrsg.) 1976: Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. Band I: Von den Anfängen bis zum 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR 4/I. Berlin 1976.
J. HERRMANN (Hrsg.) 1988: Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1. Jahrtausends u.Z. Erster Teil: Von Homer bis Plutarch (8. Jh. v.u.Z. bis 1. Jh. n.u.Z.). Schriften und Quellen der Alten Welt 37,1. Berlin 1988.
A. LUND 1998: Die ersten Germanen. Ethnizität und Ethnogenese. Heidelberg 1998.
R. MÜLLER 2002: Die Nachbarn der Kelten. Die Eisenzeit nördlich der Mittelgebirge. - In: W. MENGHIN / D. PLANCK (Hrsg.), Menschen, Zeiten, Räume - Archäologie in Deutschland. Stuttgart 2002, 220-221.
D. RAETZEL-FABIAN 2001: Kelten, Römer und Germanen. Eisenzeit in Nordhessen. Vor- und Frühgeschichte im Hessischen Landesmuseum in Kassel 4. Kassel 2001.
S. RIECKHOFF / J. BIEL 2001: Die Kelten in Deutschland. Stuttgart 2001.
S. SIEVERS 2002: Alt-Europa tritt ins Licht der Geschichte. - In: U. VON FREEDEN / S. VON SCHNURBEIN (Hrsg.), Spuren der Jahrtausende. Archäologie und Geschichte in Deutschland. Stuttgart 2002, 210-242.
M. SZABO 1991: The Celts and their Movements in the Third Century B.C. - In: S. MOSCATI (Hrsg.), The Celts [Ausstellungskatalog Venedig 1991]. Mailand 1991, 303-319.
H. P. UENZE 1991: Bavaria. - In: S. MOSCATI (Hrsg.), The Celts [Ausstellungskatalog Venedig 1991]. Mailand 1991, 265-269.
K.-H. WILLROTH 2002: Ein neuer Werkstoff - eine neue Zeit? - In: U. VON FREEDEN / S. VON SCHNURBEIN (Hrsg.), Spuren der Jahrtausende. Archäologie und Geschichte in Deutschland. Stuttgart 2002, 192-209.
Fussnoten
Datierung für das Osnabrücker Land. Weiter nördlich bzw. nordöstlich wird der Beginn der vorrömischen Eisenzeit um bis zu anderthalb Jahrhunderte später angesetzt. ↩
Das heißt Germanen diesseits des Rheins (von Gallien aus betrachtet). ↩
Cäsar selbst hat es nur zweimal für kurze Zeit betreten, nämlich während zweier Rheinüberschreitungen, die den Zweck hatten, die Bevölkerung jenseits des Rheins mit der römischen Militärmaschinerie und ihrer fortgeschrittenen Ingenieurstechnik einzuschüchtern. Seine Kenntnisse des Inneren Germaniens, die er in einem längeren Exkurs des Bellum Gallicum zusammenfasst, beruhen daher auf Hörensagen, dessen fragwürdige Qualität durch einen skurrilen zoologischen Bericht erhellt wird: Laut Cäsar gab es in den Wäldern Germaniens ein großes Säugetier namens Elch, das sich, da ihm Kniegelenke fehlten, zum Schlafen an einen Baum lehnen musste. Die Germanen jagten dieses Tier, indem sie die zum Schlafen genutzten Bäume ansägten, so dass es beim Anlehnen umstürzte. Es scheint, als sei Cäsar hier statt eines Elches ein Bär aufgebunden worden. ↩
Nach dieser Vorstellung gingen die Bevölkerung Norddeutschlands, des Mittelgebirgsraums und vermutlich sogar keltische Restbevölkerung in den Germanen auf. Bezeichnenderweise entstehen in diesem Gebiet in der Römischen Kaiserzeit auch zwei archäologisch sehr wohl unterscheidbare Formen germanischer Kultur: auf der einen Seite die Elbgermanen, auf der anderen die Rhein-Weser-Germanen. Hierin spiegelt sich die kulturell unterschiedliche Herkunft dieser beiden Gruppierungen wider. ↩
Dies klingt zunächst banal. Man muss sich jedoch bewusst machen, dass Menschen mit ihrem Trachtschmuck die Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen und den in ihnen geltenden sozialen Rollen zum Ausdruck bringen. Es handelt sich also nicht bloß um Modeschmuck. ↩
Die archäologischen Hinterlassenschaften dieser Menschen werden unter dem Begriff Poienesti Lukashevka-Kultur zusammengefasst. ↩
Eine Vorstellung der für beide Seiten katastrophalen Verhältnisse geben vielleicht die Winterlager der Landsknechtsarmeen des Dreißigjährigen Kriegs, in denen zahlreiche Menschen Hunger und Krankheit zum Opfer fielen und um die herum ganze Landstriche von den marodierenden Söldnern ausgeplündert wurden. ↩
Der Begriff Oppidum geht auf Gaius Julius Cäsar zurück, der damit keltische stadtartige Befestigungen beschrieb, die er bei der Eroberung Galliens antraf. Oppida gab es aber auch im östlichen Teil der keltischen Welt. Sie bildeten Zentren für Handel und Handwerk und manche von ihnen waren deutlich größer als selbst mittelalterliche Städte. ↩
Solche gab es ganz vereinzelt auch in der vorrömischen Eisenzeit, wie die unlängst bei Wittorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) untersuchte Befestigungsanlage verdeutlicht. Sie ist derzeit aber einmalig in Norddeutschland, was eine Einschätzung ihrer Bedeutung nicht gerade einfach macht. ↩
Weiterführende Links
Unter der Adresse www.schnippenburg.de finden Sie weitere Informationen zur Ausstellung.
Zusätzlich finden Sie in unserem Guide im Bereich Themen / Eisenzeitliche Befestigungen eine Zusammenstellung von Links zum Thema.